Rechtsfolgen einer temporären Zusammenarbeit
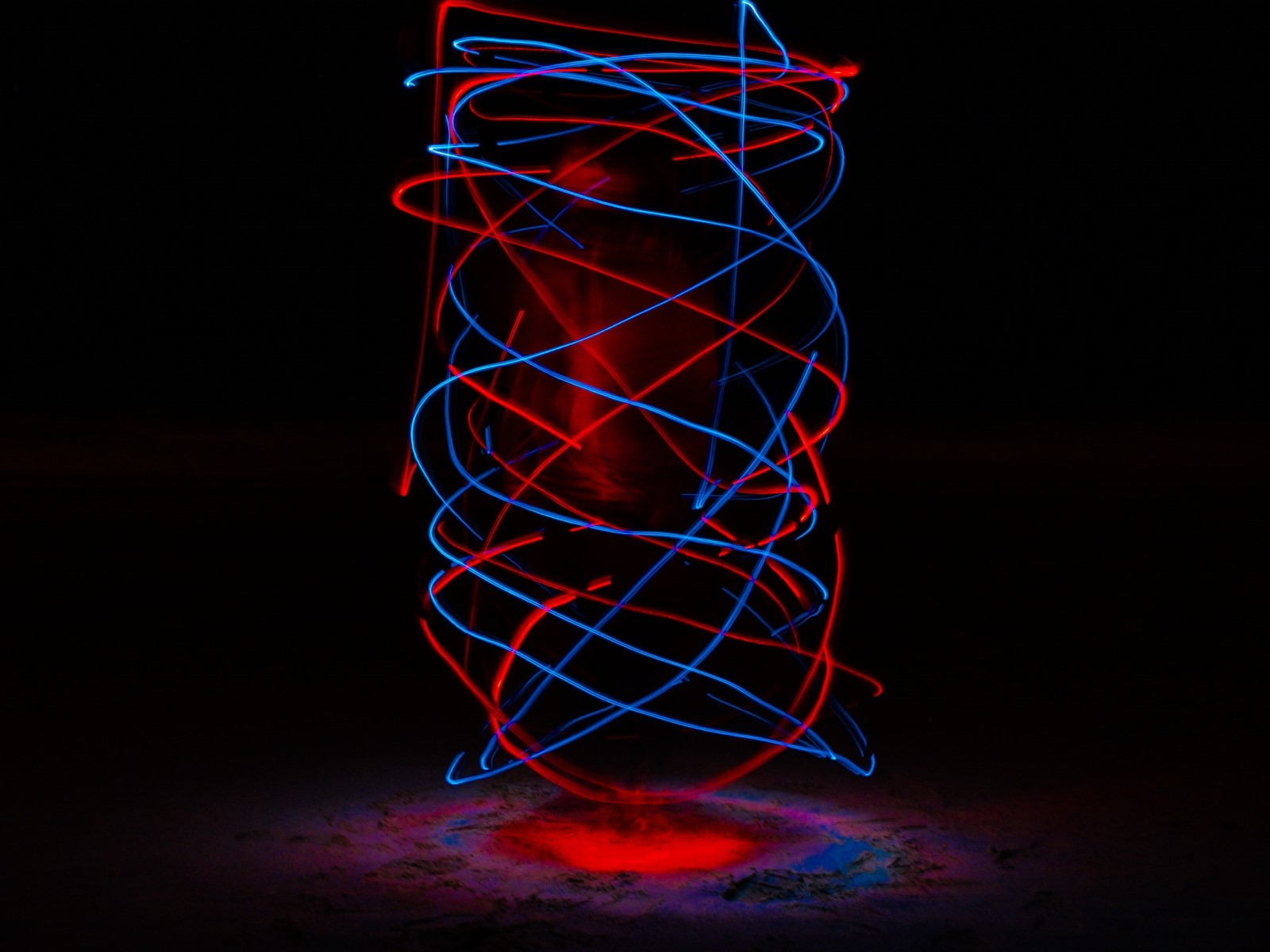
Zahlreiche Kulturtätige schließen sich immer wieder kurzfristig zu sogenannten Arbeitsgemeinschaften zusammen, wählen sich einen gemeinsamen Namen und treten dann nach außen unter dieser Projektbezeichnung auf. Über die einzelnen Rechtsfolgen einer derartigen wenn auch nur temporären Zusammenarbeit werden im Regelfall kaum konkrete (schriftliche) Vereinbarungen geschlossen.
Ohne auf jeden Einzelfall einzugehen, ist anzunehmen, dass es sich bei derartigen Konstruktionen in rechtlicher Hinsicht um sogenannte Gesellschaften bürgerlichen Rechts gemäß § 1175 ABGB handelt. Bei dieser im allgemeinen Wirtschaftsleben häufigen Form der Zusammenarbeit (man denke etwa nur an die Arbeitsgemeinschaften bei größeren Bauvorhaben) handelt es sich um Zusammenschlüsse von einzelnen Personen zu einem bestimmten Gesellschaftszweck. Wesentlich daran ist, dass die ARGE bereits durch eine formlose mündliche Erklärung zustande kommt, selbst die faktische und konkludente Zusammenarbeit zu einem bestimmten Zweck kann dazu führen, dass eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts "gegründet" wird.
Sobald man sich zu einem konkreten gemeinsamen Zweck zusammenschließt, also eine Art gemeinsames Ziel definiert und zur Umsetzung desselben entsprechend beiträgt, kann eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts vorliegen. Die gesetzlichen Bestimmungen, wer nunmehr in welchen Fällen welche Haftungen übernimmt, wer die Gesellschaft nach außen vertreten darf oder auch wie allfällige Einnahmen zwischen den Gesellschafter*innen zu teilen sind, ist in allererster Linie von den getroffenen Vereinbarungen abhängig. Wenn solche nicht vorliegen, dann greifen die gesetzlichen Bestimmungen des ABGB, insbesondere also gemäß den §§ 1175 ff ABGB. Der Gesetzgeber hat sich allerdings bei der Regelung dieser sehr einfachen und freien Form der gemeinsamen wirtschaftlichen Betätigung sehr zurückgehalten.
Es ist daher jeder Einzelfall gesondert zu prüfen, insbesondere auch deshalb, da der Grundsatz des Vorranges der getroffenen Vereinbarung wichtig ist. Nachdem diese auch mündlich getroffen werden kann, kommt es immer wieder zu Streitigkeiten über die Frage des Inhalts und der Auslegung dieser (mündlichen Verträge).
Eine GesbR kann als Außengesellschaft oder als bloße Innengesellschaft errichtet werden. Bei der tatsächlich nach außen – im Regelfall unter eigener Bezeichnung auftretenden – Außengesellschaft schließen die Gesellschafter*innen tatsächlich für die GesbR Rechtsgeschäfte ab, z. B. als für die „Arge Rechtsfragen Kultur“. Da die GesbR jedoch keine juristische Person darstellt, bleiben die Gesellschafter*innen die Rechtsträger*innen. An ihnen „haften“ die Rechte und Pflichten der Gesellschaft. Unter anderem dadurch unterscheidet sich die GesbR von anderen Gesellschaftsformen, wie z. B. einer GmbH oder einem Verein, denen jeweils eigene Rechtspersönlichkeit zukommt, die also selbst über die Rechte und Pflichten verfügen können.
Als wesentliche Empfehlung zur Vermeidung möglicher Auseinandersetzungen empfiehlt es sich, eine wenn auch einfach gehaltene schriftliche Vereinbarung zwischen den jeweils zusammen arbeitenden Personen abzuschließen. Darin sollte zumindest der konkrete Zweck der Gesellschaft, die Frage, wer die Gesellschaft nach außen vertreten darf sowie die wesentlichen finanziellen Fragen geregelt werden. Vor allem letztere sollten auch im Hinblick auf mögliche sozialversicherungs- und finanzrechtliche Folgen unter Beiziehung von Fachleuten fixiert werden.
RA Mag. Mathias Kapferer
Rechtsanwälte Tschütscher Kapferer
Burggraben 4/4, 6020 Innsbruck
Tel. +43-(0)512-581959
findet ihr bei den Musterverträgen von MICA-Austria ("Bandvertrag")
TKI - Tiroler Kulturinitiativen
Dreiheiligenstraße 21 a
c/o Die Bäckerei
6020 Innsbruck
Öffnungszeiten:
MO-DO: 9 - 12 Uhr, MO: 14 - 16 Uhr
und nach Vereinbarung

Der TKI-Newsletter informiert einmal monatlich über Veranstaltungen, Aktivitäten und neue Mitglieder der TKI, über kulturpolitische Themen sowie über Ausschreibung und ausgewählte Projekte der Förderschiene TKI open. Er enthält außerdem Ausschreibungen und Jobs im Kulturbereich und Literaturtipps aus der TKI-Bibliothek.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Cleverreach, welches ebenfalls eine Verbindung zu Google, u.a. reCAPTCHA aufbaut. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenMit Ihrer Anmeldung erlauben Sie uns, Ihnen regelmäßig unseren Newsletter an die genannte E-Mail-Adresse zu senden. Sobald Sie sich für den Newsletter angemeldet haben, senden wir Ihnen ein E-Mail, in dem Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Die von Ihnen angegebenen Daten werden ausschließlich für diesen Zweck verwendet. Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den Newsletterversand können Sie jederzeit widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein entsprechender Link. Hier können Sie unsere Datenschutzerklärung nachlesen.